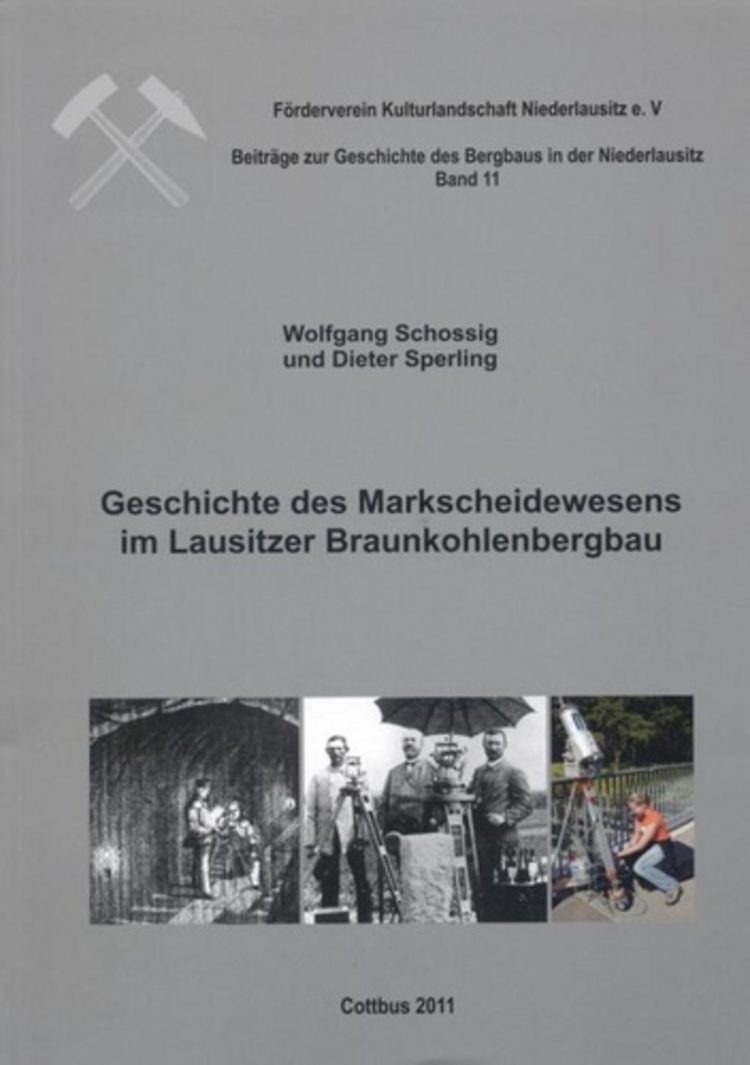Der nunmehr bereits 11. Band der Reihe „Beiträge zur Geschichte des Bergbaus in der Niederlausitz” ist soeben erschienen. Er ist der „Geschichte des Markscheidewesens im Lausitzer Braunkohlenbergbau” gewidmet. Die Autoren Wolfgang Schossig und Dieter Sperling schließen mit dieser Publikation des Förderverein Kulturlandschaft Niederlausitz e.V. eine weitere Lücke in der Geschichte des Braunkohlebergbaus der Lausitz. Der Markscheider ist laut Wikipedia ein im Bergwerk tätiger Vermessungsingenieur, der eine Konzession und eine zusätzliche staatliche Ausbildung erhalten hat.
Der Förderverein Kulturlandschaft Niederlausitz e.V. und die Bezirksgruppe Elbe-Neiße des Deutschen Markscheider Vereins e.V. präsentieren das Buch erstmalig am Donnerstag, dem 25.08.2011 um 17:00 Uhr in 01968 Senftenberg, Knappenstraße 1 im Barbarasaal des Behörden- und Dienstleistungszentrums.
Nach einem Überblick über die Buchreihe zur Geschichte des Bergbaus in der Niederlausitz durch Dr. Dieter Kahl (Förderverein Kulturlandschaft Niederlausitz e.V.) werden die Autoren Wolfgang Schossig und Dieter Sperling ihr neues Werk vorstellen. Nach der anschließenden Diskussion steht das Buch erstmalig zum Verkauf.
Der Förderverein Kulturlandschaft Niederlausitz e.V. und die Bezirksgruppe Elbe-Neiße des Deutschen Markscheider Vereins e.V. laden alle Interessierten zur Teilnahme an der Präsentation ein.
Inhaltsangabe:
Ausgehend von einem kurzen Abriß zur Geschichte des Markscheidewesens bis zum Beginn des Braunkohlenbergbaues in der Niederlausitz in der Mitte des 19. Jahrhunderts sowie der geschichtlichen Entwicklung von Geodäsie und Kartografie werden die für das Fachgebiet, die Ausbildung, Zulassung und Tätigkeit der Markscheider im 19. und 20.Jahrhundert in der Niederlausitz wesentliche gesetzliche und behördliche Vorschriften vorgestellt. In umfangreichen Recherchen wurden für den Zeitraum von ca. 1860 bis 1945 alle Markscheider ermittelt, die als Freiberufler für die Erstellung und Bearbeitung der Risswerke von ca. 200 Braunkohlengruben zuständig waren. Ihre Wirkungskreise wurden ermittelt und analysiert.
Für den Zeitraum ab 1945, mit Markscheidereien in den Braunkohlenwerken und fest angestellten Markscheidern, wird deren Geschichte, Tätigkeit, strukturelle Zuordnung detailliert dargestellt. Ein weiterer Teil befasst sich mit der geschichtlichen Entwicklung der von den Markscheidern verwendeten Instrumente und Geräte, der Entwicklung der Technologien der markscheiderischen Arbeiten, von Photogrammetrie, Aerophotogrammetrie, Risstechnik und Rechentechnik. Die Entwicklung von Normung/ Standardisierung im Markscheidewesen wird ebenso betrachtet wie die Berufsvereinigungen und Interessenvertretungen (Deutscher Markscheider Verein, Kammer der Technik).
Nach einem Überblick über die Ausstellung zum Markscheidewesen im Bergbaumuseum Knappenrode wird abschließend ein Ausblick auf die Zukunft des Markscheidewesens im Braunkohlenbergbau der Niederlausitz gegeben. Die Veröffentlichung wird durch Foto- und Risswerks-Teil vervollständigt.
Einer der Autoren der Veröffentlichung, zu der zahlreiche Fachkollegen wertvolle Hinweise gaben, ist Markscheider i.R. Dipl.-Ing. Wolfgang Schossig, der den Band 1 (Bergbau in der Niederlausitz) und den Band 6 (Braunkohlenbergbau auf dem Muskauer Faltenbogen) federführend erarbeitete.
Struktur:
• Was sind „Markscheider“ und Markscheidekunst/Markscheidewesen“?
• Ein Exkurs in die Geschichte des Markscheidewesens vor Beginn des Braunkohlen-bergbaus in der Niederlausitz
• Kurzer geschichtlicher Abriss zu Kartographie und Landesvermessung; Geodätische Grundlagen
– Die Entwicklung der Kartographie bis zur deutschen Reichsgründung 1871
– Die preußische Kartographie in der Zeit des Deutschen Reiches 1871 – 1919
– Geodäsie und Kartographie 1919 bis 1945 (Weimarer Republik, Drittes Reich)
– Geodäsie und Kartographie zwischen 1945 und 1989
– Geodäsie und Kartographie nach 1990 im wiedervereinten Deutschland
– Geodäsie Grundlagen: Koordinatensysteme
• Die für die Markscheider und das Markscheidewesen im Niederlausitzer Braunkohlerevier ab dem 19. Jahrhundert geltenden Rechtsgrundlagen und Vorschriften
– Die Situation bis Mitte des 19. Jahrhunderts (d. h., etwas bis zum Ende des Direktionsprinzips im Preußischen Bergrecht)
– Die Änderung der Stellung des Markscheiders vom Königlichen Beamten zum freischaffenden Gewerbetreibenden in der Mitte des 19. Jahrhunderts
– Das Markscheidewesen seit Erlass des „Allgemeinen Berggesetzes für die Preußischen Staaten – ABG“
– Die rechtlichen Bestimmungen für das Markscheidewesen auf dem Gebiet der DDR zwischen 1945 und 1990
– Das ab der Wiedervereinigung im Jahr 1990 für das Markscheidewesen in der Niederlausitz gültige bundesdeutsche Regelwerk
– Das Markscheidewesen ab 1990 im wiedervereinigten Deutschland
• Die Ausführung von Markscheider-Arbeiten
– In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
– In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
– In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
– Die ersten Markscheider im Niederlausitzer Braunkohlenrevier (Zeitraum von Mitte des 19. Jahrhunderts bis etwa 1880)
– Paul Braxator – Beispiel für ein Markscheiderleben –
– Die Markscheider im Niederlausitzer Braunkohlenrevier ab Anfang de 1880er Jahr bis 1945
– Niederlausitzer Braunkohlen-Markscheider „im Jahr 1990“ eine Momentaufnahme
– PATRZEK und/oder PATSCHEK – zu einigen sich aus den Risswerken und späteren Aktenlage ergebenden Unklarheiten, Vermutungen und Annahmen
– Markscheider in Cottbus bis 1945
– Eine zusammenfassende Betrachtung zu den Markscheidern im Braunkohlenbergbau der Niederlausitz im Zeitraum 1855 bis 1945
• Die Entstehung der Werksmarkscheidereien
• Das Markscheidewesen im Braunkohlenbergbau der Niederlausitz zwischen 1945 und 1989/90
– Der Zeitraum von 1945 bis zur Bildung der VVB Braunkohlen Cottbus 1953
– Der Zeitraum ab Gründung der VVB Braunkohle Cottbus, Sitz Senftenberg,
1953 bis zu den Strukturänderungen 1968
– Leitung der FG Markscheidewesen/Markscheider
– Gruppenmarkscheidereien
– Zentralmarkscheidereien der VVB Braunkohle Cottbus
• Markscheidewesen im Raum Lauchhammer bis 1980
– Werksmarkscheidereien von 1953 bis 1958
Quelle: Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV)
Der nunmehr bereits 11. Band der Reihe „Beiträge zur Geschichte des Bergbaus in der Niederlausitz” ist soeben erschienen. Er ist der „Geschichte des Markscheidewesens im Lausitzer Braunkohlenbergbau” gewidmet. Die Autoren Wolfgang Schossig und Dieter Sperling schließen mit dieser Publikation des Förderverein Kulturlandschaft Niederlausitz e.V. eine weitere Lücke in der Geschichte des Braunkohlebergbaus der Lausitz. Der Markscheider ist laut Wikipedia ein im Bergwerk tätiger Vermessungsingenieur, der eine Konzession und eine zusätzliche staatliche Ausbildung erhalten hat.
Der Förderverein Kulturlandschaft Niederlausitz e.V. und die Bezirksgruppe Elbe-Neiße des Deutschen Markscheider Vereins e.V. präsentieren das Buch erstmalig am Donnerstag, dem 25.08.2011 um 17:00 Uhr in 01968 Senftenberg, Knappenstraße 1 im Barbarasaal des Behörden- und Dienstleistungszentrums.
Nach einem Überblick über die Buchreihe zur Geschichte des Bergbaus in der Niederlausitz durch Dr. Dieter Kahl (Förderverein Kulturlandschaft Niederlausitz e.V.) werden die Autoren Wolfgang Schossig und Dieter Sperling ihr neues Werk vorstellen. Nach der anschließenden Diskussion steht das Buch erstmalig zum Verkauf.
Der Förderverein Kulturlandschaft Niederlausitz e.V. und die Bezirksgruppe Elbe-Neiße des Deutschen Markscheider Vereins e.V. laden alle Interessierten zur Teilnahme an der Präsentation ein.
Inhaltsangabe:
Ausgehend von einem kurzen Abriß zur Geschichte des Markscheidewesens bis zum Beginn des Braunkohlenbergbaues in der Niederlausitz in der Mitte des 19. Jahrhunderts sowie der geschichtlichen Entwicklung von Geodäsie und Kartografie werden die für das Fachgebiet, die Ausbildung, Zulassung und Tätigkeit der Markscheider im 19. und 20.Jahrhundert in der Niederlausitz wesentliche gesetzliche und behördliche Vorschriften vorgestellt. In umfangreichen Recherchen wurden für den Zeitraum von ca. 1860 bis 1945 alle Markscheider ermittelt, die als Freiberufler für die Erstellung und Bearbeitung der Risswerke von ca. 200 Braunkohlengruben zuständig waren. Ihre Wirkungskreise wurden ermittelt und analysiert.
Für den Zeitraum ab 1945, mit Markscheidereien in den Braunkohlenwerken und fest angestellten Markscheidern, wird deren Geschichte, Tätigkeit, strukturelle Zuordnung detailliert dargestellt. Ein weiterer Teil befasst sich mit der geschichtlichen Entwicklung der von den Markscheidern verwendeten Instrumente und Geräte, der Entwicklung der Technologien der markscheiderischen Arbeiten, von Photogrammetrie, Aerophotogrammetrie, Risstechnik und Rechentechnik. Die Entwicklung von Normung/ Standardisierung im Markscheidewesen wird ebenso betrachtet wie die Berufsvereinigungen und Interessenvertretungen (Deutscher Markscheider Verein, Kammer der Technik).
Nach einem Überblick über die Ausstellung zum Markscheidewesen im Bergbaumuseum Knappenrode wird abschließend ein Ausblick auf die Zukunft des Markscheidewesens im Braunkohlenbergbau der Niederlausitz gegeben. Die Veröffentlichung wird durch Foto- und Risswerks-Teil vervollständigt.
Einer der Autoren der Veröffentlichung, zu der zahlreiche Fachkollegen wertvolle Hinweise gaben, ist Markscheider i.R. Dipl.-Ing. Wolfgang Schossig, der den Band 1 (Bergbau in der Niederlausitz) und den Band 6 (Braunkohlenbergbau auf dem Muskauer Faltenbogen) federführend erarbeitete.
Struktur:
• Was sind „Markscheider“ und Markscheidekunst/Markscheidewesen“?
• Ein Exkurs in die Geschichte des Markscheidewesens vor Beginn des Braunkohlen-bergbaus in der Niederlausitz
• Kurzer geschichtlicher Abriss zu Kartographie und Landesvermessung; Geodätische Grundlagen
– Die Entwicklung der Kartographie bis zur deutschen Reichsgründung 1871
– Die preußische Kartographie in der Zeit des Deutschen Reiches 1871 – 1919
– Geodäsie und Kartographie 1919 bis 1945 (Weimarer Republik, Drittes Reich)
– Geodäsie und Kartographie zwischen 1945 und 1989
– Geodäsie und Kartographie nach 1990 im wiedervereinten Deutschland
– Geodäsie Grundlagen: Koordinatensysteme
• Die für die Markscheider und das Markscheidewesen im Niederlausitzer Braunkohlerevier ab dem 19. Jahrhundert geltenden Rechtsgrundlagen und Vorschriften
– Die Situation bis Mitte des 19. Jahrhunderts (d. h., etwas bis zum Ende des Direktionsprinzips im Preußischen Bergrecht)
– Die Änderung der Stellung des Markscheiders vom Königlichen Beamten zum freischaffenden Gewerbetreibenden in der Mitte des 19. Jahrhunderts
– Das Markscheidewesen seit Erlass des „Allgemeinen Berggesetzes für die Preußischen Staaten – ABG“
– Die rechtlichen Bestimmungen für das Markscheidewesen auf dem Gebiet der DDR zwischen 1945 und 1990
– Das ab der Wiedervereinigung im Jahr 1990 für das Markscheidewesen in der Niederlausitz gültige bundesdeutsche Regelwerk
– Das Markscheidewesen ab 1990 im wiedervereinigten Deutschland
• Die Ausführung von Markscheider-Arbeiten
– In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
– In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
– In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
– Die ersten Markscheider im Niederlausitzer Braunkohlenrevier (Zeitraum von Mitte des 19. Jahrhunderts bis etwa 1880)
– Paul Braxator – Beispiel für ein Markscheiderleben –
– Die Markscheider im Niederlausitzer Braunkohlenrevier ab Anfang de 1880er Jahr bis 1945
– Niederlausitzer Braunkohlen-Markscheider „im Jahr 1990“ eine Momentaufnahme
– PATRZEK und/oder PATSCHEK – zu einigen sich aus den Risswerken und späteren Aktenlage ergebenden Unklarheiten, Vermutungen und Annahmen
– Markscheider in Cottbus bis 1945
– Eine zusammenfassende Betrachtung zu den Markscheidern im Braunkohlenbergbau der Niederlausitz im Zeitraum 1855 bis 1945
• Die Entstehung der Werksmarkscheidereien
• Das Markscheidewesen im Braunkohlenbergbau der Niederlausitz zwischen 1945 und 1989/90
– Der Zeitraum von 1945 bis zur Bildung der VVB Braunkohlen Cottbus 1953
– Der Zeitraum ab Gründung der VVB Braunkohle Cottbus, Sitz Senftenberg,
1953 bis zu den Strukturänderungen 1968
– Leitung der FG Markscheidewesen/Markscheider
– Gruppenmarkscheidereien
– Zentralmarkscheidereien der VVB Braunkohle Cottbus
• Markscheidewesen im Raum Lauchhammer bis 1980
– Werksmarkscheidereien von 1953 bis 1958
Quelle: Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV)