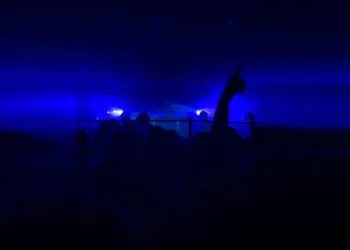Die niederlausitzische „Maśica Serbska“ wurde 1880 in Cottbus gegründet. Sie ist Teil des oberlausitzischen „Vereins für wendische Volksbildung“ – Maćica Serbska, der bereits seit 1847 besteht und damit die älteste Vereinigung der Sorben ist. Die Cottbuser Abteilung will sich um die „Pflege der niederlausitzisch-wendischen Sprache“ kümmern und „gute populäre, in dieser Sprache verfasste Schriften für das Volk“ herausgeben. Hauptinitiator dieser Gründung war der polnische Rechtsanwalt Alfons Parczewski, der auch den Startschuss für die erfolgreiche Realisierung dieser Vorhaben gab, indem er (zum größten Teil) auf eigene Kosten den Buchkalender Pratyja (die ersten 3 Jahrgänge:1880–1882) herausgab. Das hochgestellte Ziel wird tatsächlich erreicht, obwohl die Mitgliedschaft in der Niederlausitz – anders als in der Oberlausitz – nicht hauptsächlich Intellektuelle sind, sondern Bauern, Handwerker und Gewerbetreibende.
Schon im Oktober des Gründungsjahres bildet die Cottbuser Maśica eine Kommission „zur Unterstützung Theologie studierender Wenden“, um dem Mangel an evangelischen Pfarrern und Lehrern sorbischer Zunge in der Niederlausitz abzuhelfen. Der Anstoß dazu kommt wieder von Parczewski, der die Existenz einer solchen Kommission in Bautzen als nachahmenswert findet. Mitbegründer der niederlausitzischen Maśica ist auch das deutsche Sprachgenie und Freund kleiner Völker, Georg Sauerwein. Als Nebeneffekt der Maśica-Arbeit kann auch die „Jungsorbische Bewegung“ in der Niederlausitz in der Zeit von 1891 bis 1906 gelten. Niedersorbische Gymnasiasten, Seminaristen und Studenten beginnen sich zu organisieren. Sie gründen Vereine, mit dem Ziel, die niedersorbische Sprache und Kultur zu erhalten. Neben der Durchführung von Sprachkursen begründeten sie auch die Tradition niedersorbischer Gesangfeste. Das erste fand 1893 in der „Bleiche“ in Burg statt. Es wurde aber noch fast ausschließlich von obersorbischen Studenten gestaltet. Aber der Funke zündete! Das Jahr darauf führten es schon niedersorbische Jugendliche durch, ohne auf obersorbische Hilfe angewiesen zu sein. Deutsch-nationalistische amtliche Forderungen, „die wendische Sprache zu Grabe zu tragen“ ließen diese Kulturäußerungen wieder verstummen. 1906 findet das vorläufig letzte große niedersorbische Konzert statt.
In der Zeit des ersten Weltkrieges schlief auch die Maśica, wie fast die gesamte Kulturarbeit, ob deutsch oder wendisch. Aber nach dem Kriege, besonders in den 20er und 30er Jahren, erlebten die Bemühungen um Erhalt und Pflege der niedersorbischen Sprache und Kultur eine wahre Blütezeit. Den Höhepunkt im Wirken der Maśica bildete das Jahr 1930. Am 10. August organisierte sie aus Anlass des 50. Jubiläums der Maśica als „Verein wendischer Bücherfreunde“ mit maßgeblicher Hilfe des Vetschauer Fremdenverkehrsvereins ein großes ,,Wendisches Volksfest mit Trachtenschau“. Mit dieser bislang einmaligen Präsenz niedersorbischer Sprache und Kultur beginnt eine sehr aktive Arbeitsphase der Maśica. Die Mitglieder organisieren zahlreiche Kulturabende in den umliegenden Dörfern. Zugleich fordern sie in einer Petition an die Regierung „die grundsätzliche Anerkennung des wendischen Volkstums, Pflege derselben durch die Schule und Förderung durch die Organe des Staates“. Diesen Aktivitäten wird immer offener mit Argwohn und Diffamierung begegnet. Wendische Kulturtätige werden als Landesverräter diskriminiert und kaltgestellt. Leider beteiligen sich auch einige Maśica – Aktivisten an diesen faschistischen Machenschaften. Bald folgt die Quittung dafür. Durch ständige Behinderungen, Gleichschaltungsversuche und zuletzt durch Enteignung aller materiellen Werte im Jahre 1941 wurde jegliche Arbeit der Maśica Serbska unterbunden.
Nach dem II. Weltkrieg scheitert eine Reorganisation in der Niederlausitz. Erst 1993 kommt es zur Neugründung der Maśica Serbska in Cottbus. Heute repräsentiert sich die Vereinigung als relativ selbständige Abteilung innerhalb der „Wissenschaftlichen Gesellschaft – Maćica Serbska“, die sich bereits zwei Jahre zuvor in Bautzen neu konstituiert hatte. Sie bemüht sich, das sorbische Kulturleben vor allem mit sorbischsprachigen Veranstaltungen und sorabistischen Schriften zu bereichern. Die Maćica / Maśica Serbska leistet innerhalb der Domowina, der sie seit 1992 angehört, einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Nationalbewusstseins der Sorben.
Hauptakteur bei der Neugründung der niedersorbischen Maśica war deren erster Vorsitzender Měto Pernak aus Berlin. Mit viel Engagement, Ausdauer und Geschick im Umgang mit den Menschen, hat er es verstanden, die Maśica zur anerkannten und stark beachteten Organisation zu entwickeln. Daran hatte auch Manfred Starosta als Leiter der Niedersorbischen Sprachkommission (seit 1979) und Hauptautor niedersorbischer Wörterbücher seinen Anteil. Und der derzeitige Vorsitzende Dr. Peter Schurmann trägt durch seine Forschungen und Editionen zur Geschichte der Niederlausitz und seiner Bewohner entscheidend zur Klärung historischer Zusammenhänge bei, zur Entwirrung verschiedenster Voreingenommenheiten und Entstellungen, die den zurückliegenden Gesellschaftssystemen eigen, ja typisch waren. Besonders verdient gemacht hat sich bei der Popularisierung niedersorbischen Kulturgutes dieses Haus, in dem wir uns eben befinden, das wohlbekannte Wendische Museum, das aus der Kulturlandschaft unserer Region nicht mehr wegzudenken ist.
Ist also alles in Ordnung in unserer bikulturellen Landschaft? Beileibe nicht! Seit der Wende vor mehr als 20 Jahren haben wir als wesentliches Merkmal des politischen Systems die Meinungs- und Pressefreiheit. Leider führte die Anwendung und Nutzung dieser Grundrechte in unseren Angelegenheiten zu vielen Irritationen, die sich sehr negativ auswirken.
Begriffliches: Sorben–Wenden. In den Medien hört und liest man immer wieder von Sorben und Wenden, wobei die Sorben als die Oberlausitzer und die Wenden als Niederlausitzer betrachtet werden. Es wurde in Pressebeiträgen tatsächlich schon gezählt, wie viel Sorben und wie viel Wenden es in Cottbus gibt. Dabei zählt ja die obersorbische Sprache auch zu den vielen wendischen Sprachen, die es einmal gab. Aber diese Trennung wird oft politisch gebraucht. Wie könnte es sonst sein, dass ein überzeugter Wende das Wendische Haus in Cottbus als Sorbisches Haus bezeichnet? Weil die meisten Angestellten in diesem Haus Mitglieder der Domowina sind. Aber, dass diese (meistens) aus der Niederlausitz stammen, niedersorbisch/wendisch sprechen und von Obersorbisch keine oder wenig Ahnung haben, wird nicht akzeptiert. Derselbe Wende verlangt aber auch, dass das Niedersorbische Gymnasium bald Wendisches Gymnasium heißen müsste, weil es doch in Cottbus schon ein Wendisches Viertel, ein Wendisches Museum und ein Wendisches Haus gibt. Purer Dilletantismus! Schlimm daran ist, dass es sich dabei um Menschen handelt, die ernsthaft daran interessiert sind, die traditionelle niedersorbische/wendische Sprache zu erhalten. Nur sie erkennen die Zeichen der Zeit nicht!
Traditionelles Brauchtum zu pflegen ist wieder in. Zuweilen wird dabei auch die dazu gehörende sorbische Sprache (meistens nur in Ansätzen) genutzt. Leider aber vertreten manche die Ansicht, dass es nicht stimmt, wenn man meint, dass alles hin wäre, wenn die Sprache verloren ginge. Die Bräuche pflegen allein würde auch reichen. Ein tragischer Irrtum!
Geschichtliches wird neben wissenschaftlichen, ernst zu nehmenden Arbeiten oft genug auch auf kulturellem Gebiet genutzt. Eine gewisse künstlerische Freiheit ist diesen Werken ohne weiteres zuzugestehen. Aber sie darf der Historie nicht diametral entgegenstehen. Leider kommt es immer wieder zu solchen Fehlleistungen. Jüngstes Beispiel: Auf dem Schlossberg in Burg wurde zu Pfingsten der 5. Teil des Theaterspektakels „Der Wendenkönig und der schwarze Ritter“ aufgeführt. Lobend zu erwähnen, dass auch die sorbische Sprache mit einbezogen wurde, dass zweisprachige Kulturgruppen mitwirkten. Ob aber der Serbski kral jemals siegreich gegen die Christianisierung und Germanisierung war, ist schon zweifelhaft. Aber, dass dieser standhafte Verfechter seines Heidentums den zwar wendischen, aber christlichen Taufnamen Mato (Matäus, bzw. Matthias) trägt, ist ein Anachronismus sondergleichen. Die Zuschauer merken es nicht, und wir haben uns schon lange an solche Unzulänglichkeiten gewöhnt.
Nicht gewöhnen darf man sich aber an Äußerungen, die unser ganzes Bemühen in Frage stellen. Solche gibt es leider auch. Zum Beispiel hat die freie Kulturzeitschrift Hermann in ihrer Aprilausgabe 2010 in der Rubrik Laut gedacht unter der Überschrift ,,Was nicht allein besteht – vergeht“ sich gegen alle unsere, das Sorbische erhaltenden Anstrengungen gewandt und sich frech der Lüge bedient. Der Autor Steve Sabor meint: „Doch warum wir heute eine Sprache, die nicht mehr gesprochen wird, künstlich am Leben erhalten sollen, erschließt sich mir eher nicht. Ich bin einverstanden mit Zampern, Hahnrupfen, Fastnacht, Vogelhochzeit, Maibaumwerfen… – was dem Sorben Spaß macht, soll er haben“.
Es ist also noch viel Aufklärungsarbeit unter unserer deutschen wie auch niedersorbisch/wendischen Bevölkerung zu leisten. Hoffen wir, dass diese Ausstellung viele Besucher findet, dass auch die künftige mühselige Tätigkeit der Maśica Serbska von Erfolg gekrönt sei. Allen künstlichen und objektiven Hindernissen zum Trotz!
Ja žycym toś tej wustajeńcy, kotaruž stej zestajiłej dr. Pětš Šurman a Martina Nowakojc z pomocu (wjelesych) luźi, kenž su wšake eksponaty k dispoziciji stajili, wjele wuspěcha. A Maśicy Serbskej žycymy, aby dalej na serbskem pólu dobre płody njasła, njeglědajucy na wše zadory, aby se Serbstwo hyšći dłujko zdźaržało, rownož jomu winiki južo stolěśa dłujko smjertne kjarliže spiwaju.
Beno Pětška
Der Artikel erschien in der aktuellen Ausgabe der niedersorbischen Wochenzeitung NOWY CASNIK
Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung NOWY CASNIK
Die niederlausitzische „Maśica Serbska“ wurde 1880 in Cottbus gegründet. Sie ist Teil des oberlausitzischen „Vereins für wendische Volksbildung“ – Maćica Serbska, der bereits seit 1847 besteht und damit die älteste Vereinigung der Sorben ist. Die Cottbuser Abteilung will sich um die „Pflege der niederlausitzisch-wendischen Sprache“ kümmern und „gute populäre, in dieser Sprache verfasste Schriften für das Volk“ herausgeben. Hauptinitiator dieser Gründung war der polnische Rechtsanwalt Alfons Parczewski, der auch den Startschuss für die erfolgreiche Realisierung dieser Vorhaben gab, indem er (zum größten Teil) auf eigene Kosten den Buchkalender Pratyja (die ersten 3 Jahrgänge:1880–1882) herausgab. Das hochgestellte Ziel wird tatsächlich erreicht, obwohl die Mitgliedschaft in der Niederlausitz – anders als in der Oberlausitz – nicht hauptsächlich Intellektuelle sind, sondern Bauern, Handwerker und Gewerbetreibende.
Schon im Oktober des Gründungsjahres bildet die Cottbuser Maśica eine Kommission „zur Unterstützung Theologie studierender Wenden“, um dem Mangel an evangelischen Pfarrern und Lehrern sorbischer Zunge in der Niederlausitz abzuhelfen. Der Anstoß dazu kommt wieder von Parczewski, der die Existenz einer solchen Kommission in Bautzen als nachahmenswert findet. Mitbegründer der niederlausitzischen Maśica ist auch das deutsche Sprachgenie und Freund kleiner Völker, Georg Sauerwein. Als Nebeneffekt der Maśica-Arbeit kann auch die „Jungsorbische Bewegung“ in der Niederlausitz in der Zeit von 1891 bis 1906 gelten. Niedersorbische Gymnasiasten, Seminaristen und Studenten beginnen sich zu organisieren. Sie gründen Vereine, mit dem Ziel, die niedersorbische Sprache und Kultur zu erhalten. Neben der Durchführung von Sprachkursen begründeten sie auch die Tradition niedersorbischer Gesangfeste. Das erste fand 1893 in der „Bleiche“ in Burg statt. Es wurde aber noch fast ausschließlich von obersorbischen Studenten gestaltet. Aber der Funke zündete! Das Jahr darauf führten es schon niedersorbische Jugendliche durch, ohne auf obersorbische Hilfe angewiesen zu sein. Deutsch-nationalistische amtliche Forderungen, „die wendische Sprache zu Grabe zu tragen“ ließen diese Kulturäußerungen wieder verstummen. 1906 findet das vorläufig letzte große niedersorbische Konzert statt.
In der Zeit des ersten Weltkrieges schlief auch die Maśica, wie fast die gesamte Kulturarbeit, ob deutsch oder wendisch. Aber nach dem Kriege, besonders in den 20er und 30er Jahren, erlebten die Bemühungen um Erhalt und Pflege der niedersorbischen Sprache und Kultur eine wahre Blütezeit. Den Höhepunkt im Wirken der Maśica bildete das Jahr 1930. Am 10. August organisierte sie aus Anlass des 50. Jubiläums der Maśica als „Verein wendischer Bücherfreunde“ mit maßgeblicher Hilfe des Vetschauer Fremdenverkehrsvereins ein großes ,,Wendisches Volksfest mit Trachtenschau“. Mit dieser bislang einmaligen Präsenz niedersorbischer Sprache und Kultur beginnt eine sehr aktive Arbeitsphase der Maśica. Die Mitglieder organisieren zahlreiche Kulturabende in den umliegenden Dörfern. Zugleich fordern sie in einer Petition an die Regierung „die grundsätzliche Anerkennung des wendischen Volkstums, Pflege derselben durch die Schule und Förderung durch die Organe des Staates“. Diesen Aktivitäten wird immer offener mit Argwohn und Diffamierung begegnet. Wendische Kulturtätige werden als Landesverräter diskriminiert und kaltgestellt. Leider beteiligen sich auch einige Maśica – Aktivisten an diesen faschistischen Machenschaften. Bald folgt die Quittung dafür. Durch ständige Behinderungen, Gleichschaltungsversuche und zuletzt durch Enteignung aller materiellen Werte im Jahre 1941 wurde jegliche Arbeit der Maśica Serbska unterbunden.
Nach dem II. Weltkrieg scheitert eine Reorganisation in der Niederlausitz. Erst 1993 kommt es zur Neugründung der Maśica Serbska in Cottbus. Heute repräsentiert sich die Vereinigung als relativ selbständige Abteilung innerhalb der „Wissenschaftlichen Gesellschaft – Maćica Serbska“, die sich bereits zwei Jahre zuvor in Bautzen neu konstituiert hatte. Sie bemüht sich, das sorbische Kulturleben vor allem mit sorbischsprachigen Veranstaltungen und sorabistischen Schriften zu bereichern. Die Maćica / Maśica Serbska leistet innerhalb der Domowina, der sie seit 1992 angehört, einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Nationalbewusstseins der Sorben.
Hauptakteur bei der Neugründung der niedersorbischen Maśica war deren erster Vorsitzender Měto Pernak aus Berlin. Mit viel Engagement, Ausdauer und Geschick im Umgang mit den Menschen, hat er es verstanden, die Maśica zur anerkannten und stark beachteten Organisation zu entwickeln. Daran hatte auch Manfred Starosta als Leiter der Niedersorbischen Sprachkommission (seit 1979) und Hauptautor niedersorbischer Wörterbücher seinen Anteil. Und der derzeitige Vorsitzende Dr. Peter Schurmann trägt durch seine Forschungen und Editionen zur Geschichte der Niederlausitz und seiner Bewohner entscheidend zur Klärung historischer Zusammenhänge bei, zur Entwirrung verschiedenster Voreingenommenheiten und Entstellungen, die den zurückliegenden Gesellschaftssystemen eigen, ja typisch waren. Besonders verdient gemacht hat sich bei der Popularisierung niedersorbischen Kulturgutes dieses Haus, in dem wir uns eben befinden, das wohlbekannte Wendische Museum, das aus der Kulturlandschaft unserer Region nicht mehr wegzudenken ist.
Ist also alles in Ordnung in unserer bikulturellen Landschaft? Beileibe nicht! Seit der Wende vor mehr als 20 Jahren haben wir als wesentliches Merkmal des politischen Systems die Meinungs- und Pressefreiheit. Leider führte die Anwendung und Nutzung dieser Grundrechte in unseren Angelegenheiten zu vielen Irritationen, die sich sehr negativ auswirken.
Begriffliches: Sorben–Wenden. In den Medien hört und liest man immer wieder von Sorben und Wenden, wobei die Sorben als die Oberlausitzer und die Wenden als Niederlausitzer betrachtet werden. Es wurde in Pressebeiträgen tatsächlich schon gezählt, wie viel Sorben und wie viel Wenden es in Cottbus gibt. Dabei zählt ja die obersorbische Sprache auch zu den vielen wendischen Sprachen, die es einmal gab. Aber diese Trennung wird oft politisch gebraucht. Wie könnte es sonst sein, dass ein überzeugter Wende das Wendische Haus in Cottbus als Sorbisches Haus bezeichnet? Weil die meisten Angestellten in diesem Haus Mitglieder der Domowina sind. Aber, dass diese (meistens) aus der Niederlausitz stammen, niedersorbisch/wendisch sprechen und von Obersorbisch keine oder wenig Ahnung haben, wird nicht akzeptiert. Derselbe Wende verlangt aber auch, dass das Niedersorbische Gymnasium bald Wendisches Gymnasium heißen müsste, weil es doch in Cottbus schon ein Wendisches Viertel, ein Wendisches Museum und ein Wendisches Haus gibt. Purer Dilletantismus! Schlimm daran ist, dass es sich dabei um Menschen handelt, die ernsthaft daran interessiert sind, die traditionelle niedersorbische/wendische Sprache zu erhalten. Nur sie erkennen die Zeichen der Zeit nicht!
Traditionelles Brauchtum zu pflegen ist wieder in. Zuweilen wird dabei auch die dazu gehörende sorbische Sprache (meistens nur in Ansätzen) genutzt. Leider aber vertreten manche die Ansicht, dass es nicht stimmt, wenn man meint, dass alles hin wäre, wenn die Sprache verloren ginge. Die Bräuche pflegen allein würde auch reichen. Ein tragischer Irrtum!
Geschichtliches wird neben wissenschaftlichen, ernst zu nehmenden Arbeiten oft genug auch auf kulturellem Gebiet genutzt. Eine gewisse künstlerische Freiheit ist diesen Werken ohne weiteres zuzugestehen. Aber sie darf der Historie nicht diametral entgegenstehen. Leider kommt es immer wieder zu solchen Fehlleistungen. Jüngstes Beispiel: Auf dem Schlossberg in Burg wurde zu Pfingsten der 5. Teil des Theaterspektakels „Der Wendenkönig und der schwarze Ritter“ aufgeführt. Lobend zu erwähnen, dass auch die sorbische Sprache mit einbezogen wurde, dass zweisprachige Kulturgruppen mitwirkten. Ob aber der Serbski kral jemals siegreich gegen die Christianisierung und Germanisierung war, ist schon zweifelhaft. Aber, dass dieser standhafte Verfechter seines Heidentums den zwar wendischen, aber christlichen Taufnamen Mato (Matäus, bzw. Matthias) trägt, ist ein Anachronismus sondergleichen. Die Zuschauer merken es nicht, und wir haben uns schon lange an solche Unzulänglichkeiten gewöhnt.
Nicht gewöhnen darf man sich aber an Äußerungen, die unser ganzes Bemühen in Frage stellen. Solche gibt es leider auch. Zum Beispiel hat die freie Kulturzeitschrift Hermann in ihrer Aprilausgabe 2010 in der Rubrik Laut gedacht unter der Überschrift ,,Was nicht allein besteht – vergeht“ sich gegen alle unsere, das Sorbische erhaltenden Anstrengungen gewandt und sich frech der Lüge bedient. Der Autor Steve Sabor meint: „Doch warum wir heute eine Sprache, die nicht mehr gesprochen wird, künstlich am Leben erhalten sollen, erschließt sich mir eher nicht. Ich bin einverstanden mit Zampern, Hahnrupfen, Fastnacht, Vogelhochzeit, Maibaumwerfen… – was dem Sorben Spaß macht, soll er haben“.
Es ist also noch viel Aufklärungsarbeit unter unserer deutschen wie auch niedersorbisch/wendischen Bevölkerung zu leisten. Hoffen wir, dass diese Ausstellung viele Besucher findet, dass auch die künftige mühselige Tätigkeit der Maśica Serbska von Erfolg gekrönt sei. Allen künstlichen und objektiven Hindernissen zum Trotz!
Ja žycym toś tej wustajeńcy, kotaruž stej zestajiłej dr. Pětš Šurman a Martina Nowakojc z pomocu (wjelesych) luźi, kenž su wšake eksponaty k dispoziciji stajili, wjele wuspěcha. A Maśicy Serbskej žycymy, aby dalej na serbskem pólu dobre płody njasła, njeglědajucy na wše zadory, aby se Serbstwo hyšći dłujko zdźaržało, rownož jomu winiki južo stolěśa dłujko smjertne kjarliže spiwaju.
Beno Pětška
Der Artikel erschien in der aktuellen Ausgabe der niedersorbischen Wochenzeitung NOWY CASNIK
Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung NOWY CASNIK
Die niederlausitzische „Maśica Serbska“ wurde 1880 in Cottbus gegründet. Sie ist Teil des oberlausitzischen „Vereins für wendische Volksbildung“ – Maćica Serbska, der bereits seit 1847 besteht und damit die älteste Vereinigung der Sorben ist. Die Cottbuser Abteilung will sich um die „Pflege der niederlausitzisch-wendischen Sprache“ kümmern und „gute populäre, in dieser Sprache verfasste Schriften für das Volk“ herausgeben. Hauptinitiator dieser Gründung war der polnische Rechtsanwalt Alfons Parczewski, der auch den Startschuss für die erfolgreiche Realisierung dieser Vorhaben gab, indem er (zum größten Teil) auf eigene Kosten den Buchkalender Pratyja (die ersten 3 Jahrgänge:1880–1882) herausgab. Das hochgestellte Ziel wird tatsächlich erreicht, obwohl die Mitgliedschaft in der Niederlausitz – anders als in der Oberlausitz – nicht hauptsächlich Intellektuelle sind, sondern Bauern, Handwerker und Gewerbetreibende.
Schon im Oktober des Gründungsjahres bildet die Cottbuser Maśica eine Kommission „zur Unterstützung Theologie studierender Wenden“, um dem Mangel an evangelischen Pfarrern und Lehrern sorbischer Zunge in der Niederlausitz abzuhelfen. Der Anstoß dazu kommt wieder von Parczewski, der die Existenz einer solchen Kommission in Bautzen als nachahmenswert findet. Mitbegründer der niederlausitzischen Maśica ist auch das deutsche Sprachgenie und Freund kleiner Völker, Georg Sauerwein. Als Nebeneffekt der Maśica-Arbeit kann auch die „Jungsorbische Bewegung“ in der Niederlausitz in der Zeit von 1891 bis 1906 gelten. Niedersorbische Gymnasiasten, Seminaristen und Studenten beginnen sich zu organisieren. Sie gründen Vereine, mit dem Ziel, die niedersorbische Sprache und Kultur zu erhalten. Neben der Durchführung von Sprachkursen begründeten sie auch die Tradition niedersorbischer Gesangfeste. Das erste fand 1893 in der „Bleiche“ in Burg statt. Es wurde aber noch fast ausschließlich von obersorbischen Studenten gestaltet. Aber der Funke zündete! Das Jahr darauf führten es schon niedersorbische Jugendliche durch, ohne auf obersorbische Hilfe angewiesen zu sein. Deutsch-nationalistische amtliche Forderungen, „die wendische Sprache zu Grabe zu tragen“ ließen diese Kulturäußerungen wieder verstummen. 1906 findet das vorläufig letzte große niedersorbische Konzert statt.
In der Zeit des ersten Weltkrieges schlief auch die Maśica, wie fast die gesamte Kulturarbeit, ob deutsch oder wendisch. Aber nach dem Kriege, besonders in den 20er und 30er Jahren, erlebten die Bemühungen um Erhalt und Pflege der niedersorbischen Sprache und Kultur eine wahre Blütezeit. Den Höhepunkt im Wirken der Maśica bildete das Jahr 1930. Am 10. August organisierte sie aus Anlass des 50. Jubiläums der Maśica als „Verein wendischer Bücherfreunde“ mit maßgeblicher Hilfe des Vetschauer Fremdenverkehrsvereins ein großes ,,Wendisches Volksfest mit Trachtenschau“. Mit dieser bislang einmaligen Präsenz niedersorbischer Sprache und Kultur beginnt eine sehr aktive Arbeitsphase der Maśica. Die Mitglieder organisieren zahlreiche Kulturabende in den umliegenden Dörfern. Zugleich fordern sie in einer Petition an die Regierung „die grundsätzliche Anerkennung des wendischen Volkstums, Pflege derselben durch die Schule und Förderung durch die Organe des Staates“. Diesen Aktivitäten wird immer offener mit Argwohn und Diffamierung begegnet. Wendische Kulturtätige werden als Landesverräter diskriminiert und kaltgestellt. Leider beteiligen sich auch einige Maśica – Aktivisten an diesen faschistischen Machenschaften. Bald folgt die Quittung dafür. Durch ständige Behinderungen, Gleichschaltungsversuche und zuletzt durch Enteignung aller materiellen Werte im Jahre 1941 wurde jegliche Arbeit der Maśica Serbska unterbunden.
Nach dem II. Weltkrieg scheitert eine Reorganisation in der Niederlausitz. Erst 1993 kommt es zur Neugründung der Maśica Serbska in Cottbus. Heute repräsentiert sich die Vereinigung als relativ selbständige Abteilung innerhalb der „Wissenschaftlichen Gesellschaft – Maćica Serbska“, die sich bereits zwei Jahre zuvor in Bautzen neu konstituiert hatte. Sie bemüht sich, das sorbische Kulturleben vor allem mit sorbischsprachigen Veranstaltungen und sorabistischen Schriften zu bereichern. Die Maćica / Maśica Serbska leistet innerhalb der Domowina, der sie seit 1992 angehört, einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Nationalbewusstseins der Sorben.
Hauptakteur bei der Neugründung der niedersorbischen Maśica war deren erster Vorsitzender Měto Pernak aus Berlin. Mit viel Engagement, Ausdauer und Geschick im Umgang mit den Menschen, hat er es verstanden, die Maśica zur anerkannten und stark beachteten Organisation zu entwickeln. Daran hatte auch Manfred Starosta als Leiter der Niedersorbischen Sprachkommission (seit 1979) und Hauptautor niedersorbischer Wörterbücher seinen Anteil. Und der derzeitige Vorsitzende Dr. Peter Schurmann trägt durch seine Forschungen und Editionen zur Geschichte der Niederlausitz und seiner Bewohner entscheidend zur Klärung historischer Zusammenhänge bei, zur Entwirrung verschiedenster Voreingenommenheiten und Entstellungen, die den zurückliegenden Gesellschaftssystemen eigen, ja typisch waren. Besonders verdient gemacht hat sich bei der Popularisierung niedersorbischen Kulturgutes dieses Haus, in dem wir uns eben befinden, das wohlbekannte Wendische Museum, das aus der Kulturlandschaft unserer Region nicht mehr wegzudenken ist.
Ist also alles in Ordnung in unserer bikulturellen Landschaft? Beileibe nicht! Seit der Wende vor mehr als 20 Jahren haben wir als wesentliches Merkmal des politischen Systems die Meinungs- und Pressefreiheit. Leider führte die Anwendung und Nutzung dieser Grundrechte in unseren Angelegenheiten zu vielen Irritationen, die sich sehr negativ auswirken.
Begriffliches: Sorben–Wenden. In den Medien hört und liest man immer wieder von Sorben und Wenden, wobei die Sorben als die Oberlausitzer und die Wenden als Niederlausitzer betrachtet werden. Es wurde in Pressebeiträgen tatsächlich schon gezählt, wie viel Sorben und wie viel Wenden es in Cottbus gibt. Dabei zählt ja die obersorbische Sprache auch zu den vielen wendischen Sprachen, die es einmal gab. Aber diese Trennung wird oft politisch gebraucht. Wie könnte es sonst sein, dass ein überzeugter Wende das Wendische Haus in Cottbus als Sorbisches Haus bezeichnet? Weil die meisten Angestellten in diesem Haus Mitglieder der Domowina sind. Aber, dass diese (meistens) aus der Niederlausitz stammen, niedersorbisch/wendisch sprechen und von Obersorbisch keine oder wenig Ahnung haben, wird nicht akzeptiert. Derselbe Wende verlangt aber auch, dass das Niedersorbische Gymnasium bald Wendisches Gymnasium heißen müsste, weil es doch in Cottbus schon ein Wendisches Viertel, ein Wendisches Museum und ein Wendisches Haus gibt. Purer Dilletantismus! Schlimm daran ist, dass es sich dabei um Menschen handelt, die ernsthaft daran interessiert sind, die traditionelle niedersorbische/wendische Sprache zu erhalten. Nur sie erkennen die Zeichen der Zeit nicht!
Traditionelles Brauchtum zu pflegen ist wieder in. Zuweilen wird dabei auch die dazu gehörende sorbische Sprache (meistens nur in Ansätzen) genutzt. Leider aber vertreten manche die Ansicht, dass es nicht stimmt, wenn man meint, dass alles hin wäre, wenn die Sprache verloren ginge. Die Bräuche pflegen allein würde auch reichen. Ein tragischer Irrtum!
Geschichtliches wird neben wissenschaftlichen, ernst zu nehmenden Arbeiten oft genug auch auf kulturellem Gebiet genutzt. Eine gewisse künstlerische Freiheit ist diesen Werken ohne weiteres zuzugestehen. Aber sie darf der Historie nicht diametral entgegenstehen. Leider kommt es immer wieder zu solchen Fehlleistungen. Jüngstes Beispiel: Auf dem Schlossberg in Burg wurde zu Pfingsten der 5. Teil des Theaterspektakels „Der Wendenkönig und der schwarze Ritter“ aufgeführt. Lobend zu erwähnen, dass auch die sorbische Sprache mit einbezogen wurde, dass zweisprachige Kulturgruppen mitwirkten. Ob aber der Serbski kral jemals siegreich gegen die Christianisierung und Germanisierung war, ist schon zweifelhaft. Aber, dass dieser standhafte Verfechter seines Heidentums den zwar wendischen, aber christlichen Taufnamen Mato (Matäus, bzw. Matthias) trägt, ist ein Anachronismus sondergleichen. Die Zuschauer merken es nicht, und wir haben uns schon lange an solche Unzulänglichkeiten gewöhnt.
Nicht gewöhnen darf man sich aber an Äußerungen, die unser ganzes Bemühen in Frage stellen. Solche gibt es leider auch. Zum Beispiel hat die freie Kulturzeitschrift Hermann in ihrer Aprilausgabe 2010 in der Rubrik Laut gedacht unter der Überschrift ,,Was nicht allein besteht – vergeht“ sich gegen alle unsere, das Sorbische erhaltenden Anstrengungen gewandt und sich frech der Lüge bedient. Der Autor Steve Sabor meint: „Doch warum wir heute eine Sprache, die nicht mehr gesprochen wird, künstlich am Leben erhalten sollen, erschließt sich mir eher nicht. Ich bin einverstanden mit Zampern, Hahnrupfen, Fastnacht, Vogelhochzeit, Maibaumwerfen… – was dem Sorben Spaß macht, soll er haben“.
Es ist also noch viel Aufklärungsarbeit unter unserer deutschen wie auch niedersorbisch/wendischen Bevölkerung zu leisten. Hoffen wir, dass diese Ausstellung viele Besucher findet, dass auch die künftige mühselige Tätigkeit der Maśica Serbska von Erfolg gekrönt sei. Allen künstlichen und objektiven Hindernissen zum Trotz!
Ja žycym toś tej wustajeńcy, kotaruž stej zestajiłej dr. Pětš Šurman a Martina Nowakojc z pomocu (wjelesych) luźi, kenž su wšake eksponaty k dispoziciji stajili, wjele wuspěcha. A Maśicy Serbskej žycymy, aby dalej na serbskem pólu dobre płody njasła, njeglědajucy na wše zadory, aby se Serbstwo hyšći dłujko zdźaržało, rownož jomu winiki južo stolěśa dłujko smjertne kjarliže spiwaju.
Beno Pětška
Der Artikel erschien in der aktuellen Ausgabe der niedersorbischen Wochenzeitung NOWY CASNIK
Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung NOWY CASNIK
Die niederlausitzische „Maśica Serbska“ wurde 1880 in Cottbus gegründet. Sie ist Teil des oberlausitzischen „Vereins für wendische Volksbildung“ – Maćica Serbska, der bereits seit 1847 besteht und damit die älteste Vereinigung der Sorben ist. Die Cottbuser Abteilung will sich um die „Pflege der niederlausitzisch-wendischen Sprache“ kümmern und „gute populäre, in dieser Sprache verfasste Schriften für das Volk“ herausgeben. Hauptinitiator dieser Gründung war der polnische Rechtsanwalt Alfons Parczewski, der auch den Startschuss für die erfolgreiche Realisierung dieser Vorhaben gab, indem er (zum größten Teil) auf eigene Kosten den Buchkalender Pratyja (die ersten 3 Jahrgänge:1880–1882) herausgab. Das hochgestellte Ziel wird tatsächlich erreicht, obwohl die Mitgliedschaft in der Niederlausitz – anders als in der Oberlausitz – nicht hauptsächlich Intellektuelle sind, sondern Bauern, Handwerker und Gewerbetreibende.
Schon im Oktober des Gründungsjahres bildet die Cottbuser Maśica eine Kommission „zur Unterstützung Theologie studierender Wenden“, um dem Mangel an evangelischen Pfarrern und Lehrern sorbischer Zunge in der Niederlausitz abzuhelfen. Der Anstoß dazu kommt wieder von Parczewski, der die Existenz einer solchen Kommission in Bautzen als nachahmenswert findet. Mitbegründer der niederlausitzischen Maśica ist auch das deutsche Sprachgenie und Freund kleiner Völker, Georg Sauerwein. Als Nebeneffekt der Maśica-Arbeit kann auch die „Jungsorbische Bewegung“ in der Niederlausitz in der Zeit von 1891 bis 1906 gelten. Niedersorbische Gymnasiasten, Seminaristen und Studenten beginnen sich zu organisieren. Sie gründen Vereine, mit dem Ziel, die niedersorbische Sprache und Kultur zu erhalten. Neben der Durchführung von Sprachkursen begründeten sie auch die Tradition niedersorbischer Gesangfeste. Das erste fand 1893 in der „Bleiche“ in Burg statt. Es wurde aber noch fast ausschließlich von obersorbischen Studenten gestaltet. Aber der Funke zündete! Das Jahr darauf führten es schon niedersorbische Jugendliche durch, ohne auf obersorbische Hilfe angewiesen zu sein. Deutsch-nationalistische amtliche Forderungen, „die wendische Sprache zu Grabe zu tragen“ ließen diese Kulturäußerungen wieder verstummen. 1906 findet das vorläufig letzte große niedersorbische Konzert statt.
In der Zeit des ersten Weltkrieges schlief auch die Maśica, wie fast die gesamte Kulturarbeit, ob deutsch oder wendisch. Aber nach dem Kriege, besonders in den 20er und 30er Jahren, erlebten die Bemühungen um Erhalt und Pflege der niedersorbischen Sprache und Kultur eine wahre Blütezeit. Den Höhepunkt im Wirken der Maśica bildete das Jahr 1930. Am 10. August organisierte sie aus Anlass des 50. Jubiläums der Maśica als „Verein wendischer Bücherfreunde“ mit maßgeblicher Hilfe des Vetschauer Fremdenverkehrsvereins ein großes ,,Wendisches Volksfest mit Trachtenschau“. Mit dieser bislang einmaligen Präsenz niedersorbischer Sprache und Kultur beginnt eine sehr aktive Arbeitsphase der Maśica. Die Mitglieder organisieren zahlreiche Kulturabende in den umliegenden Dörfern. Zugleich fordern sie in einer Petition an die Regierung „die grundsätzliche Anerkennung des wendischen Volkstums, Pflege derselben durch die Schule und Förderung durch die Organe des Staates“. Diesen Aktivitäten wird immer offener mit Argwohn und Diffamierung begegnet. Wendische Kulturtätige werden als Landesverräter diskriminiert und kaltgestellt. Leider beteiligen sich auch einige Maśica – Aktivisten an diesen faschistischen Machenschaften. Bald folgt die Quittung dafür. Durch ständige Behinderungen, Gleichschaltungsversuche und zuletzt durch Enteignung aller materiellen Werte im Jahre 1941 wurde jegliche Arbeit der Maśica Serbska unterbunden.
Nach dem II. Weltkrieg scheitert eine Reorganisation in der Niederlausitz. Erst 1993 kommt es zur Neugründung der Maśica Serbska in Cottbus. Heute repräsentiert sich die Vereinigung als relativ selbständige Abteilung innerhalb der „Wissenschaftlichen Gesellschaft – Maćica Serbska“, die sich bereits zwei Jahre zuvor in Bautzen neu konstituiert hatte. Sie bemüht sich, das sorbische Kulturleben vor allem mit sorbischsprachigen Veranstaltungen und sorabistischen Schriften zu bereichern. Die Maćica / Maśica Serbska leistet innerhalb der Domowina, der sie seit 1992 angehört, einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Nationalbewusstseins der Sorben.
Hauptakteur bei der Neugründung der niedersorbischen Maśica war deren erster Vorsitzender Měto Pernak aus Berlin. Mit viel Engagement, Ausdauer und Geschick im Umgang mit den Menschen, hat er es verstanden, die Maśica zur anerkannten und stark beachteten Organisation zu entwickeln. Daran hatte auch Manfred Starosta als Leiter der Niedersorbischen Sprachkommission (seit 1979) und Hauptautor niedersorbischer Wörterbücher seinen Anteil. Und der derzeitige Vorsitzende Dr. Peter Schurmann trägt durch seine Forschungen und Editionen zur Geschichte der Niederlausitz und seiner Bewohner entscheidend zur Klärung historischer Zusammenhänge bei, zur Entwirrung verschiedenster Voreingenommenheiten und Entstellungen, die den zurückliegenden Gesellschaftssystemen eigen, ja typisch waren. Besonders verdient gemacht hat sich bei der Popularisierung niedersorbischen Kulturgutes dieses Haus, in dem wir uns eben befinden, das wohlbekannte Wendische Museum, das aus der Kulturlandschaft unserer Region nicht mehr wegzudenken ist.
Ist also alles in Ordnung in unserer bikulturellen Landschaft? Beileibe nicht! Seit der Wende vor mehr als 20 Jahren haben wir als wesentliches Merkmal des politischen Systems die Meinungs- und Pressefreiheit. Leider führte die Anwendung und Nutzung dieser Grundrechte in unseren Angelegenheiten zu vielen Irritationen, die sich sehr negativ auswirken.
Begriffliches: Sorben–Wenden. In den Medien hört und liest man immer wieder von Sorben und Wenden, wobei die Sorben als die Oberlausitzer und die Wenden als Niederlausitzer betrachtet werden. Es wurde in Pressebeiträgen tatsächlich schon gezählt, wie viel Sorben und wie viel Wenden es in Cottbus gibt. Dabei zählt ja die obersorbische Sprache auch zu den vielen wendischen Sprachen, die es einmal gab. Aber diese Trennung wird oft politisch gebraucht. Wie könnte es sonst sein, dass ein überzeugter Wende das Wendische Haus in Cottbus als Sorbisches Haus bezeichnet? Weil die meisten Angestellten in diesem Haus Mitglieder der Domowina sind. Aber, dass diese (meistens) aus der Niederlausitz stammen, niedersorbisch/wendisch sprechen und von Obersorbisch keine oder wenig Ahnung haben, wird nicht akzeptiert. Derselbe Wende verlangt aber auch, dass das Niedersorbische Gymnasium bald Wendisches Gymnasium heißen müsste, weil es doch in Cottbus schon ein Wendisches Viertel, ein Wendisches Museum und ein Wendisches Haus gibt. Purer Dilletantismus! Schlimm daran ist, dass es sich dabei um Menschen handelt, die ernsthaft daran interessiert sind, die traditionelle niedersorbische/wendische Sprache zu erhalten. Nur sie erkennen die Zeichen der Zeit nicht!
Traditionelles Brauchtum zu pflegen ist wieder in. Zuweilen wird dabei auch die dazu gehörende sorbische Sprache (meistens nur in Ansätzen) genutzt. Leider aber vertreten manche die Ansicht, dass es nicht stimmt, wenn man meint, dass alles hin wäre, wenn die Sprache verloren ginge. Die Bräuche pflegen allein würde auch reichen. Ein tragischer Irrtum!
Geschichtliches wird neben wissenschaftlichen, ernst zu nehmenden Arbeiten oft genug auch auf kulturellem Gebiet genutzt. Eine gewisse künstlerische Freiheit ist diesen Werken ohne weiteres zuzugestehen. Aber sie darf der Historie nicht diametral entgegenstehen. Leider kommt es immer wieder zu solchen Fehlleistungen. Jüngstes Beispiel: Auf dem Schlossberg in Burg wurde zu Pfingsten der 5. Teil des Theaterspektakels „Der Wendenkönig und der schwarze Ritter“ aufgeführt. Lobend zu erwähnen, dass auch die sorbische Sprache mit einbezogen wurde, dass zweisprachige Kulturgruppen mitwirkten. Ob aber der Serbski kral jemals siegreich gegen die Christianisierung und Germanisierung war, ist schon zweifelhaft. Aber, dass dieser standhafte Verfechter seines Heidentums den zwar wendischen, aber christlichen Taufnamen Mato (Matäus, bzw. Matthias) trägt, ist ein Anachronismus sondergleichen. Die Zuschauer merken es nicht, und wir haben uns schon lange an solche Unzulänglichkeiten gewöhnt.
Nicht gewöhnen darf man sich aber an Äußerungen, die unser ganzes Bemühen in Frage stellen. Solche gibt es leider auch. Zum Beispiel hat die freie Kulturzeitschrift Hermann in ihrer Aprilausgabe 2010 in der Rubrik Laut gedacht unter der Überschrift ,,Was nicht allein besteht – vergeht“ sich gegen alle unsere, das Sorbische erhaltenden Anstrengungen gewandt und sich frech der Lüge bedient. Der Autor Steve Sabor meint: „Doch warum wir heute eine Sprache, die nicht mehr gesprochen wird, künstlich am Leben erhalten sollen, erschließt sich mir eher nicht. Ich bin einverstanden mit Zampern, Hahnrupfen, Fastnacht, Vogelhochzeit, Maibaumwerfen… – was dem Sorben Spaß macht, soll er haben“.
Es ist also noch viel Aufklärungsarbeit unter unserer deutschen wie auch niedersorbisch/wendischen Bevölkerung zu leisten. Hoffen wir, dass diese Ausstellung viele Besucher findet, dass auch die künftige mühselige Tätigkeit der Maśica Serbska von Erfolg gekrönt sei. Allen künstlichen und objektiven Hindernissen zum Trotz!
Ja žycym toś tej wustajeńcy, kotaruž stej zestajiłej dr. Pětš Šurman a Martina Nowakojc z pomocu (wjelesych) luźi, kenž su wšake eksponaty k dispoziciji stajili, wjele wuspěcha. A Maśicy Serbskej žycymy, aby dalej na serbskem pólu dobre płody njasła, njeglědajucy na wše zadory, aby se Serbstwo hyšći dłujko zdźaržało, rownož jomu winiki južo stolěśa dłujko smjertne kjarliže spiwaju.
Beno Pětška
Der Artikel erschien in der aktuellen Ausgabe der niedersorbischen Wochenzeitung NOWY CASNIK
Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung NOWY CASNIK