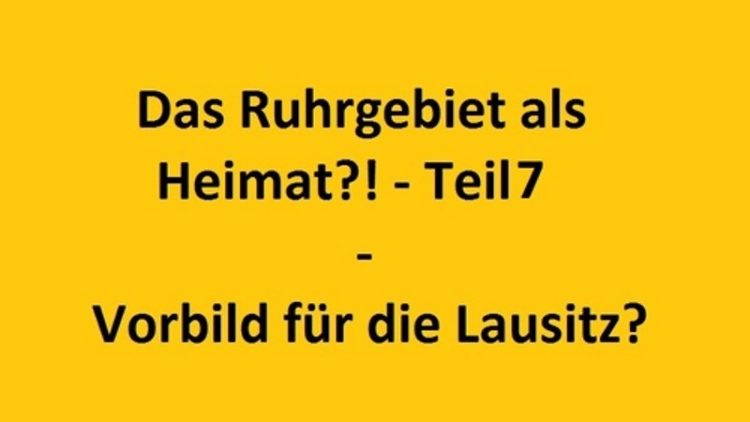Nachdem im letzten Teil die herannahende Krise betrachtet wurde, macht der neue Teil einen Exkurs in die Siedlungsstrukturen des Ruhrgebiets, um verschiedene Sachverhalte herauszustellen.
Zu Beginn der frühindustriellen Phase lebten die Menschen in einfachen einstöckigen Kötterhäusern. Auch die ersten Migranten wurden in Kotten untergebracht. Doch bald reichte der Wohnraum nicht mehr aus. Ställe, Schuppen und Scheunen wurden zu Wohnquartieren umgebaut (vgl. Parent 1991, S.25). Um 1850 entstanden die ersten Mietshäuser bzw. Mietskasernen. Der Zeitraum zwischen 1850 und dem ersten Weltkrieg prägte die Siedlungsstruktur im Ruhrgebiet nachhaltig. Recht planlos wurden neben der neuen Zeche mehrere zwei- bis dreistöckige Mietshäuser errichtet (vgl. Parent 1991, S.13 ff.). Mit den günstigen Wohnungen versuchten die Industriellen Arbeitskräfte aus dem Ausland in das Ruhrgebiet zu locken. Die Wohnbedingungen waren schlecht. Meistens waren die Arbeiterwohnungen überfüllt, sodass sich aufgrund der schlechten hygienischen Verhältnisse leicht Epidemien ausbreiteten (vgl. Parent 1991, S.25). In den 1890er Jahren wurden Sechs- und Achtfamilienhäuser errichtet, was die Situation nicht verbesserte. Die Gebäude rückten noch näher zusammen (vgl. Parent 1991, S.28).
Hunderte neue Siedlungskerne „aus der Dreiheit Zeche, Bergarbeitersiedlung und Vorortszentrum“ entstanden (Parent 1991, S.15). „Bereits 1873 gab es im Revier insgesamt 5930 zecheneigene Wohnungen, um die Jahrhundertwende waren es 26245 und beim Ausbruch des ersten Weltkriegs 94027“ (Parent 1991, S.27). Der rasante Wohnungsbau ließ aus kleinen Orten ein „Revier der großen Dörfer“ entstehen (vgl. Boldt, Gelhar 2008, S.49). Städte bildeten sich nahezu automatisch, sodass es zu einem Wirrwarr von Ein- und Umgemeindungen sowie Stadtumbenennungen kam. Die Urbanität wurde das Opfer der landschaftlichen Dynamik der Hochindustrialisierungsphase (vgl. Boldt, Gelhar 2008, S.49). Ohne Rücksicht auf Verluste wurde die traditionelle Kulturlandschaft zerstört und musste der expandierenden Industrie weichen.
Die Städte bzw. Dörfer formierten sich um die Industrieanlage herum. Die werksnahe Lage mit Sichtachsen auf das Werkstor war charakteristisch für die neuen Siedlungen. Im Mittelpunkt stand die Arbeitsstätte (vgl. Parent 1991, S.51). Für den Arbeiter vereinigten sich Wohnung und Arbeit (vgl. Parent 1991, S.15). Das Leben in den Vororten der Stadt und auf den Dörfern war überschaubar (vgl. Boldt, Gelhar 2008, S.62). Das enge Zusammenleben in den Werkskolonien mit den Nachbarn und die gemeinsame Arbeit schuf eine Art „Heimat-Assoziation“ bei den Menschen. Zwischen Kneipe, Büdchen und Sportplatz entwickelten sich ein kumpelhaftes Zusammensein und die Leidenschaft für den Fußball (vgl. Parent 1991, S.27).
Erst nach der Jahrhundertwende entstand durch die stets chaotisch räumlichen Verhältnisse die Idee, die Raumordnung extern über einen Verein zu organisieren. Doch durch den ersten Weltkrieg kam es erst 1920 zur Gründung des Siedlungsverbandes Ruhrkohlebezirk (SVR) (unbenannt 1979 zu Kommunalverband Ruhr (KVR) und 2004 zu Regionalverband Ruhr (RVR)) (vgl. Von Petz 1995, S.40ff.). Bis dahin konnten kulturelle und infrastrukturelle Einrichtungen nur mit Hilfe der Großindustriellen verwirklicht werden. Meist waren die Denkmäler jedoch nicht für die Allgemeinheit gedacht, sondern dienten vielmehr ihrem Repräsentationsbedürfnis. Es kam zwar Ende der 1920er Jahre zur kommunalen Raumveränderung durch Industrielle, dennoch konnte nicht von einer Umgestaltung der vorindustriellen Landschaft gesprochen werden. „Bis weit in die 1930er Jahre gab es in [den] Städten kaum städtische Funktionen“ (Boldt, Gelhar 2008, S.50). Grund war das Fehlen einer breiten bürgerlichen Schicht als Kulturträger (vgl. Boldt, Gelhar 2008, S.50).
Trotz allem wurde nach der Jahrhundertwende mehr Wert auf die Größe der Wohnungen und auf deren Umgebung gelegt. So entstanden nach dem englischen Vorbild die ersten Gartenstadtsiedlungen und Siedlungshäuser im Kreuzgrundriss (vgl. Parent 1991 27ff.). Es wurde versucht die ehemals dörfliche Idylle wiederherzustellen. Die Straßenführung wurde dem Gelände abgepasst und die verschiedenen Haustypen variierten, sodass insgesamt wieder ein harmonischer Gesamteindruck zwischen Natur und Industrie beziehungsweise Freizeit und Arbeit geschaffen wurde. Zudem wurden hinter den großzügigen Koloniehäuser Schrebergärten angelegt. Das kleine Gartenstück wurde von den Bergarbeitern zur Gartenarbeit und Viehhaltung genutzt und stellte eine angenehme Feierabendbeschäftigung dar (vgl. Parent 1991, S.28).
Der nächste Teil geht auf den Strukturwandel im Ruhrgebiet ein
Nachdem im letzten Teil die herannahende Krise betrachtet wurde, macht der neue Teil einen Exkurs in die Siedlungsstrukturen des Ruhrgebiets, um verschiedene Sachverhalte herauszustellen.
Zu Beginn der frühindustriellen Phase lebten die Menschen in einfachen einstöckigen Kötterhäusern. Auch die ersten Migranten wurden in Kotten untergebracht. Doch bald reichte der Wohnraum nicht mehr aus. Ställe, Schuppen und Scheunen wurden zu Wohnquartieren umgebaut (vgl. Parent 1991, S.25). Um 1850 entstanden die ersten Mietshäuser bzw. Mietskasernen. Der Zeitraum zwischen 1850 und dem ersten Weltkrieg prägte die Siedlungsstruktur im Ruhrgebiet nachhaltig. Recht planlos wurden neben der neuen Zeche mehrere zwei- bis dreistöckige Mietshäuser errichtet (vgl. Parent 1991, S.13 ff.). Mit den günstigen Wohnungen versuchten die Industriellen Arbeitskräfte aus dem Ausland in das Ruhrgebiet zu locken. Die Wohnbedingungen waren schlecht. Meistens waren die Arbeiterwohnungen überfüllt, sodass sich aufgrund der schlechten hygienischen Verhältnisse leicht Epidemien ausbreiteten (vgl. Parent 1991, S.25). In den 1890er Jahren wurden Sechs- und Achtfamilienhäuser errichtet, was die Situation nicht verbesserte. Die Gebäude rückten noch näher zusammen (vgl. Parent 1991, S.28).
Hunderte neue Siedlungskerne „aus der Dreiheit Zeche, Bergarbeitersiedlung und Vorortszentrum“ entstanden (Parent 1991, S.15). „Bereits 1873 gab es im Revier insgesamt 5930 zecheneigene Wohnungen, um die Jahrhundertwende waren es 26245 und beim Ausbruch des ersten Weltkriegs 94027“ (Parent 1991, S.27). Der rasante Wohnungsbau ließ aus kleinen Orten ein „Revier der großen Dörfer“ entstehen (vgl. Boldt, Gelhar 2008, S.49). Städte bildeten sich nahezu automatisch, sodass es zu einem Wirrwarr von Ein- und Umgemeindungen sowie Stadtumbenennungen kam. Die Urbanität wurde das Opfer der landschaftlichen Dynamik der Hochindustrialisierungsphase (vgl. Boldt, Gelhar 2008, S.49). Ohne Rücksicht auf Verluste wurde die traditionelle Kulturlandschaft zerstört und musste der expandierenden Industrie weichen.
Die Städte bzw. Dörfer formierten sich um die Industrieanlage herum. Die werksnahe Lage mit Sichtachsen auf das Werkstor war charakteristisch für die neuen Siedlungen. Im Mittelpunkt stand die Arbeitsstätte (vgl. Parent 1991, S.51). Für den Arbeiter vereinigten sich Wohnung und Arbeit (vgl. Parent 1991, S.15). Das Leben in den Vororten der Stadt und auf den Dörfern war überschaubar (vgl. Boldt, Gelhar 2008, S.62). Das enge Zusammenleben in den Werkskolonien mit den Nachbarn und die gemeinsame Arbeit schuf eine Art „Heimat-Assoziation“ bei den Menschen. Zwischen Kneipe, Büdchen und Sportplatz entwickelten sich ein kumpelhaftes Zusammensein und die Leidenschaft für den Fußball (vgl. Parent 1991, S.27).
Erst nach der Jahrhundertwende entstand durch die stets chaotisch räumlichen Verhältnisse die Idee, die Raumordnung extern über einen Verein zu organisieren. Doch durch den ersten Weltkrieg kam es erst 1920 zur Gründung des Siedlungsverbandes Ruhrkohlebezirk (SVR) (unbenannt 1979 zu Kommunalverband Ruhr (KVR) und 2004 zu Regionalverband Ruhr (RVR)) (vgl. Von Petz 1995, S.40ff.). Bis dahin konnten kulturelle und infrastrukturelle Einrichtungen nur mit Hilfe der Großindustriellen verwirklicht werden. Meist waren die Denkmäler jedoch nicht für die Allgemeinheit gedacht, sondern dienten vielmehr ihrem Repräsentationsbedürfnis. Es kam zwar Ende der 1920er Jahre zur kommunalen Raumveränderung durch Industrielle, dennoch konnte nicht von einer Umgestaltung der vorindustriellen Landschaft gesprochen werden. „Bis weit in die 1930er Jahre gab es in [den] Städten kaum städtische Funktionen“ (Boldt, Gelhar 2008, S.50). Grund war das Fehlen einer breiten bürgerlichen Schicht als Kulturträger (vgl. Boldt, Gelhar 2008, S.50).
Trotz allem wurde nach der Jahrhundertwende mehr Wert auf die Größe der Wohnungen und auf deren Umgebung gelegt. So entstanden nach dem englischen Vorbild die ersten Gartenstadtsiedlungen und Siedlungshäuser im Kreuzgrundriss (vgl. Parent 1991 27ff.). Es wurde versucht die ehemals dörfliche Idylle wiederherzustellen. Die Straßenführung wurde dem Gelände abgepasst und die verschiedenen Haustypen variierten, sodass insgesamt wieder ein harmonischer Gesamteindruck zwischen Natur und Industrie beziehungsweise Freizeit und Arbeit geschaffen wurde. Zudem wurden hinter den großzügigen Koloniehäuser Schrebergärten angelegt. Das kleine Gartenstück wurde von den Bergarbeitern zur Gartenarbeit und Viehhaltung genutzt und stellte eine angenehme Feierabendbeschäftigung dar (vgl. Parent 1991, S.28).
Der nächste Teil geht auf den Strukturwandel im Ruhrgebiet ein